Erbrechner: Gesetzlicher Erbteil berechnen

Zuletzt aktualisiert:
Ihre Lesezeit:
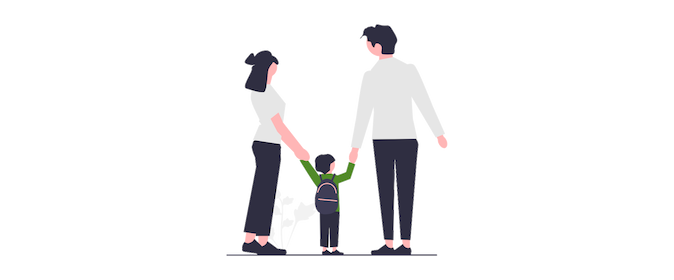
Gesetzlicher Erbteil
- Ohne Testament gilt die gesetzliche Erbfolge: Der gesetzliche Erbteil ist die Nachlassquote, die Verwandte nach festen Regeln erhalten. Maßgeblich sind die Verwandtschaftsordnungen und eine eigenständige Quote des Ehegatten; die nähere Ordnung schließt fernere aus.
- Kinder erben zuerst – nach Ordnungen: Abkömmlinge bilden die 1. Ordnung, Eltern und Geschwister die 2., Großeltern die 3.; solange Erben einer höheren Ordnung vorhanden sind, gehen nachrangige leer aus. Enkel treten nur ein, wenn ihr Elternteil (das Kind des Erblassers) bereits weggefallen ist.
- Der Erbteil des Ehegatten hängt vom Güterstand ab: In der Zugewinngemeinschaft erhält der Ehegatte i. d. R. 1/2 neben Kindern (und 3/4 neben Eltern/Großeltern); in der Gütertrennung bekommt er so viel wie ein Kind (z. B. 1/2 bei einem Kind, 1/3 bei zwei, 1/4 bei drei+), in der Gütergemeinschaft 1/4 neben Abkömmlingen.

Inhaltsverzeichnis
- Gesetzlicher Erbteil – Grundlagen der gesetzlichen Erbfolge
- Pflichtteil vs. gesetzlicher Erbteil – Unterschiede und Ansprüche bei Enterbung
- Gesetzlicher Erbteil des Ehegatten – Einfluss des Güterstands
- Kinder als Erben – gesetzlicher Erbteil und Pflichtteilsansprüche
- Berliner Testament – Folgen für gesetzlichen Erbteil und Pflichtteil
- Pflichtteil geltend machen – Fristen und Verjährung
- Schenkungen und Pflichtteil – der Pflichtteilsergänzungsanspruch
Gesetzlicher Erbteil – Grundlagen der gesetzlichen Erbfolge
Der gesetzliche Erbteil ist der Nachlassanteil, der ohne Testament oder Erbvertrag nach festen Regeln verteilt wird. Erben werden nach Ordnungen und dem Verwandtschaftsgrad bestimmt; Ehegatten erhalten eigene gesetzliche Quoten. Der RECHNER.APP Erbrechner berechnet Ihnen in Sekunden, wer nach deutschem Recht welchen Anteil am Nachlass erhält.
Was ist der gesetzliche Erbteil?
Der gesetzliche Erbteil ist die Quote am Nachlass, die ein Erbe nach der gesetzlichen Erbfolge erhält, wenn keine wirksame letztwillige Verfügung existiert. Die Höhe richtet sich nach der Stellung des Erben in der Verwandtenordnung und danach, ob ein Ehegatte vorhanden ist. Ohne Testament gilt immer: Die nächsthöhere Ordnung schließt die nachfolgenden Ordnungen aus.
Gesetzliche Erbfolge bedeutet: Der Gesetzgeber ordnet die Nachlassverteilung, damit keine Lücke entsteht. Kinder (und deren Abkömmlinge) gehören zur ersten Ordnung und erben vor allen anderen Verwandten. Der überlebende Ehegatte erbt zusätzlich nach besonderen Quoten, die sich je nach Güterstand unterscheiden; Details dazu folgen im Beitrag. So entsteht eine vorhersehbare, transparente Verteilung – individuell gestaltbar bleibt sie nur durch Testament.
Gesetzliche Erbfolge – wer erbt in welcher Reihenfolge?
Die gesetzliche Erbfolge ordnet Erben in sogenannte Ordnungen ein; die nähere Ordnung schließt die fernere aus. Abkömmlinge (Kinder, Enkel) bilden die erste Ordnung, Eltern und Geschwister die zweite, Großeltern und deren Abkömmlinge die dritte. Der Ehegatte erbt stets neben Verwandten nach eigenen Quoten.
Die Reihenfolge der gesetzlichen Erben lässt sich am leichtesten über die Ordnungen verstehen. Erst wenn keine Erben der ersten Ordnung vorhanden sind, kommen die der zweiten Ordnung zum Zug, danach erst die dritte Ordnung usw. So ist klar, warum Kinder vor Geschwistern erben und weshalb Enkel nur erben, wenn ihr Elternteil (das Kind des Erblassers) bereits weggefallen ist.
Zur schnellen Orientierung die Kerngruppen der gesetzlichen Erbfolge:
- 1. Ordnung: Abkömmlinge des Erblassers (Kinder, Enkel, Urenkel) – sie erben zuerst; lebende Kinder schließen Enkel aus.
- 2. Ordnung: Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge (Geschwister, Nichten/Neffen) – sie kommen nur zum Zug, wenn keine Erben erster Ordnung existieren.
- 3. Ordnung: Großeltern und deren Abkömmlinge (Tanten, Onkel, Cousins) – nur relevant, wenn es weder Erben erster noch zweiter Ordnung gibt.
Ein einfaches Zahlenbild hilft: Beträgt der Reinnachlass 100.000 €, erhält der Ehegatte in der Zugewinngemeinschaft 50.000 €. Haben zwei Kinder geerbt, teilen sie sich die übrigen 50.000 € je zur Hälfte (25.000 €). Existieren drei Kinder, erhält jedes ein Sechstel des Nachlasses, wenn der Ehegatte die Hälfte bekommt. Abweichungen ergeben sich bei anderen Güterständen – diese werden im gesonderten Kapitel erläutert.
Sie haben ein rechtliches Anliegen zum Erben und Vererben?

Mein Partner KLUGO verhilft Ihnen zu Ihrem Recht! Mit individuellen rechtlichen Lösungen und der persönlichen Beratung beim Rechtsexperten werden Ihre Fragen geklärt. Sie erfahren, welche Chancen und Risiken bestehen. Auf Wunsch können Sie den Rechtsanwalt im Anschluss direkt beauftragen.
- Soforthilfe bei Rechtsfragen: Ihre Situation, Ihre Chancen und Ihre Risiken
- Beratung durch erfahrene Anwälte & Rechtsexperten
- Ortsunabhängig, persönlich und digital
Pflichtteil vs. gesetzlicher Erbteil – Unterschiede und Ansprüche bei Enterbung
Der gesetzliche Erbteil bestimmt den Anteil am Nachlass, den ein Erbe nach der gesetzlichen Erbfolge erhält. Der Pflichtteil dagegen ist ein Geldanspruch für bestimmte Angehörige, wenn sie durch Testament oder Erbvertrag enterbt wurden. Er beträgt stets die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und kann nur in Geld verlangt werden.
Unterschied zwischen gesetzlichem Erbteil und Pflichtteil
Der gesetzliche Erbteil entsteht automatisch, wenn keine wirksame Verfügung von Todes wegen vorliegt. Der Pflichtteil greift nur dann, wenn ein naher Angehöriger durch Testament ausgeschlossen wurde. Er beträgt 50 % des gesetzlichen Erbteils (§ 2303 BGB) und sichert so einen Mindestanspruch gegen die Erben.
Praktisch bedeutet das: Wer enterbt wurde, erhält zwar keine Stellung als Erbe, kann aber den Pflichtteil als Geldbetrag einfordern. Damit unterscheidet sich der Pflichtteil klar vom Erbteil, der eine Beteiligung an der gesamten Erbmasse – einschließlich Vermögensgegenständen – vermittelt.
- Gesetzlicher Erbteil: Anteil am Nachlass nach der gesetzlichen Erbfolge, wenn kein Testament vorliegt.
- Pflichtteil: Geldanspruch für enterbte Angehörige in Höhe von 50 % des gesetzlichen Erbteils.
- Auszahlung: Der Pflichtteil wird ausschließlich in Geld ausgezahlt, nicht in Gegenständen.
Wer ist pflichtteilsberechtigt?
Pflichtteilsberechtigt sind nur die nächsten Angehörigen. Dazu gehören die Kinder des Erblassers, deren Abkömmlinge (Enkel, wenn das Kind vorverstorben ist), der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner und in bestimmten Fällen die Eltern des Erblassers. Andere Verwandte wie Geschwister oder Stiefkinder sind ausgeschlossen.
Damit wird sichergestellt, dass der engste Familienkreis auch gegen den Willen des Erblassers nicht vollständig leer ausgeht. Wichtig ist, dass uneheliche und adoptierte Kinder den gleichen Pflichtteilsanspruch haben wie eheliche Kinder.
- Ehegatte/Lebenspartner: Pflichtteilsberechtigt, solange die Ehe/Partnerschaft bestand und § 1933 BGB nicht greift.
- Kinder: Pflichtteilsrecht für alle leiblichen und adoptierten Kinder; uneheliche Kinder sind gleichgestellt.
- Enkel: treten ein, wenn ihr Elternteil (Kind des Erblassers) bereits verstorben ist.
- Eltern: nur pflichtteilsberechtigt, wenn der Erblasser keine Kinder hatte.
- Nicht pflichtteilsberechtigt: Geschwister, Stiefkinder, Großeltern und entferntere Verwandte.
Höhe des Pflichtteils und Berechnung
Die Pflichtteilsquote beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Grundlage ist der Reinnachlass (Nachlasswert nach Abzug von Schulden). Aus dieser Summe wird der gesetzliche Erbteil errechnet und anschließend halbiert, um den Pflichtteil zu bestimmen. Der Anspruch wird immer in Geld erfüllt.
| Gesetzlicher Erbteil | Pflichtteil (50 %) |
|---|---|
| 1/2 (50 %) | 1/4 (25 %) |
| 1/3 (~33 %) | 1/6 (~16,7 %) |
| 1/4 (25 %) | 1/8 (12,5 %) |
| 1/8 (12,5 %) | 1/16 (6,25 %) |
Gesetzlicher Erbteil des Ehegatten – Einfluss des Güterstands
Der gesetzliche Erbteil des Ehegatten richtet sich nicht nur nach der Zahl der vorhandenen Kinder, sondern auch nach dem Güterstand der Ehe. In der Zugewinngemeinschaft erbt der Ehepartner neben Kindern grundsätzlich die Hälfte (gesetzliche Quote zuzüglich pauschalem Zugewinnausgleich), in der Gütertrennung variieren die Quoten nach Kinderzahl, und in der Gütergemeinschaft gelten die Quoten des § 1931 BGB ohne § 1371-Zuschlag. Diese Unterschiede sind in §§ 1931, 1371 BGB geregelt.
Zugewinngemeinschaft – Ehegattenerbteil mit pauschalem Zugewinn
Die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Normalfall, wenn kein Ehevertrag geschlossen wurde. Der Ehegatte erbt nach § 1931 BGB zunächst ein Viertel des Nachlasses und erhält nach § 1371 BGB pauschal ein weiteres Viertel als Zugewinnausgleich. Zusammen ergibt das in der Regel die Hälfte des Nachlasses neben Kindern. Neben Eltern und Großeltern (zweite bzw. dritte Ordnung) beträgt die Quote des Ehegatten regelmäßig drei Viertel.
Alternativ zur pauschalen Lösung kann der Zugewinn in besonderen Konstellationen auch güterrechtlich real abgerechnet werden. Dann verbleibt erbrechtlich die Quote nach § 1931 (z. B. 1/4 neben Kindern), der konkrete Zugewinnausgleich wird getrennt ermittelt.
Ohne Erben der 1.–3. Ordnung (keine Abkömmlinge, keine Eltern/Geschwister, keine Großeltern) wird der Ehegatte Alleinerbe des gesamten Nachlasses.
- Neben Kindern: Ehegatte erbt i. d. R. 1/2 des Nachlasses (1/4 gesetzlich + 1/4 Zugewinnausgleich).
- Neben Eltern/Großeltern: Ehegatte erbt i. d. R. 3/4 des Nachlasses.
- Allein (ohne Erben 1.–3. Ordnung): Ehegatte erbt 100 %.
Gütertrennung – variable Erbquote des Ehegatten
Bei vereinbarter Gütertrennung entfällt der pauschale Zugewinnausgleich. Der Ehegatte erhält nach § 1931 Abs. 4 BGB so viel wie ein Kind. Damit ergeben sich variable Quoten: Bei einem Kind erhält der Ehegatte 1/2, bei zwei Kindern 1/3, bei drei oder mehr Kindern 1/4. Gibt es keine Kinder, erbt er die Hälfte neben Erben zweiter Ordnung.
- 1 Kind: Ehegatte 1/2, Kind 1/2.
- 2 Kinder: Ehegatte 1/3, jedes Kind 1/3.
- 3 oder mehr Kinder: Ehegatte 1/4, Kinder zusammen 3/4.
- Keine Kinder (aber Eltern/Geschwister): Ehegatte 1/2, Erben zweiter Ordnung 1/2.
Gütergemeinschaft – Erbquote des Ehegatten nach § 1931 BGB
In der Gütergemeinschaft gehört das Vermögen (Gesamtgut) beiden Ehegatten gemeinsam. Es gibt keinen pauschalen § 1371-Zuschlag. Die Erbquote des überlebenden Ehegatten richtet sich daher ausschließlich nach § 1931 BGB:
- Neben Abkömmlingen: 1/4.
- Neben Erben zweiter Ordnung oder Großeltern: 1/2.
- Keine Erben der 1.–3. Ordnung: Ehegatte wird Alleinerbe.
Unabhängig davon behält der überlebende Ehegatte seinen eigenen Anteil am Gesamtgut.
Kinder als Erben – gesetzlicher Erbteil und Pflichtteilsansprüche
Kinder gehören zur ersten Ordnung der gesetzlichen Erbfolge und erben in der Regel den gesamten Nachlass zu gleichen Teilen. Existiert ein Ehegatte, teilen sich Kinder den Anteil, der dem Ehegatten nicht zusteht. Werden Kinder enterbt, haben sie Anspruch auf den Pflichtteil, der die Hälfte ihres gesetzlichen Erbteils beträgt (§ 2303 BGB).
Gesetzlicher Erbteil der Kinder
Der gesetzliche Erbteil der Kinder richtet sich nach der Zahl der Kinder und dem Vorhandensein eines Ehegatten. Ohne Ehegatte erben alle Kinder zu gleichen Teilen. Mit Ehegatte wird der Nachlass zwischen Ehepartner und Kindern nach festen Quoten geteilt. Kinder schließen ihre eigenen Abkömmlinge aus; Enkel erben nur, wenn das jeweilige Kind bereits verstorben ist.
Adoptierte Kinder sind den leiblichen gleichgestellt. Uneheliche Kinder haben ebenfalls volles Erbrecht, wenn die Abstammung anerkannt ist. Stiefkinder sind dagegen ohne Adoption nicht gesetzlich erbberechtigt und gehen leer aus.
- Gleiches Recht für alle Kinder: Eheliche, nichteheliche und adoptierte Kinder erben zu gleichen Teilen.
- Enkel als Ersatzerben: Enkel treten nur ein, wenn das jeweilige Kind des Erblassers bereits verstorben ist.
- Stiefkinder: Ohne Adoption kein gesetzlicher Erbteil und kein Pflichtteil.
Pflichtteil für enterbte Kinder
Enterbte Kinder haben nach § 2303 BGB Anspruch auf den Pflichtteil. Dieser beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und wird immer in Geld erfüllt. Ein Kind geht somit nie vollständig leer aus, selbst wenn ein Testament es von der Erbfolge ausschließt.
 Gesetzlicher Erbteil: Meine weiteren Artikel
Gesetzlicher Erbteil: Meine weiteren Artikel
 Erbrechner: Erbquote online berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbrechner: Erbquote online berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 23. Mai 2025 Erbrechner: Gesetzliche Erbfolge berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbrechner: Gesetzliche Erbfolge berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 11. September 2025
Berliner Testament – Folgen für gesetzlichen Erbteil und Pflichtteil
Ein Berliner Testament setzt die Ehegatten gegenseitig als Alleinerben ein. Die Kinder erben erst als Schlusserben nach dem Tod des zweiten Elternteils. Das stärkt den überlebenden Ehepartner, kann aber Pflichtteilsansprüche der Kinder beim ersten Erbfall auslösen und zu finanziellen Belastungen führen.
Was ist ein Berliner Testament?
Ein Berliner Testament ist ein gemeinsames Testament von Ehegatten. Dabei wird festgelegt, dass beim Tod des ersten Partners der überlebende Ehegatte Alleinerbe wird. Die Kinder erhalten ihren Erbteil erst nach dem Tod des zweiten Elternteils als Schlusserben. Dadurch wird der Nachlass zunächst zusammengehalten.
Für den überlebenden Ehegatten bedeutet das finanzielle Sicherheit, da er über das gesamte Vermögen verfügen kann. Für die Kinder hingegen bedeutet es eine Enterbung im ersten Erbfall, die nur durch den Pflichtteil ausgeglichen werden kann.
Pflichtteilsstrafklausel – Kinder vom Pflichtteil abhalten
Viele Berliner Testamente enthalten eine Pflichtteilsstrafklausel. Sie soll verhindern, dass Kinder nach dem Tod des ersten Elternteils ihren Pflichtteil fordern. In der Klausel wird festgelegt: Fordert ein Kind beim ersten Erbfall den Pflichtteil, verliert es auch den Anspruch auf das Erbe beim zweiten Erbfall.
Damit sollen die Kinder motiviert werden, auf den Pflichtteil zu verzichten, um beim zweiten Todesfall den vollen Erbteil zu erhalten. So wird der überlebende Ehegatte vor finanziellen Belastungen geschützt.
Folgen des Berliner Testaments – Vorteile und Nachteile
Das Berliner Testament hat sowohl Vorteile für Ehepartner als auch Nachteile für die Kinder. Es stärkt den überlebenden Ehegatten, führt aber oft zu Pflichtteilsforderungen und kann dadurch Liquiditätsprobleme verursachen. Bei internationalem Bezug ist zudem die Europäische Erbrechtsverordnung (EuErbVO) zu beachten.
- Vorteil – Absicherung: Der überlebende Ehegatte wird Alleinerbe und kann frei über das Vermögen verfügen.
- Nachteil – Kinder enterbt: Die Kinder erhalten ihren Erbteil erst nach dem Tod des zweiten Elternteils.
- Pflichtteilsanspruch: Kinder können beim ersten Erbfall dennoch 50 % ihres gesetzlichen Erbteils als Pflichtteil einfordern.
- Liquiditätsrisiko: Die Auszahlung des Pflichtteils kann den überlebenden Ehepartner wirtschaftlich überlasten.
Pflichtteil geltend machen – Fristen und Verjährung
Pflichtteilsansprüche müssen rechtzeitig geltend gemacht werden. Die regelmäßige Verjährung beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der Berechtigte vom Erbfall und seiner Enterbung erfährt (§§ 195, 199 BGB). Spätestens nach 30 Jahren erlischt jeder Pflichtteilsanspruch endgültig.
Verjährungsfristen für den Pflichtteil
Die gesetzliche Verjährungsfrist für Pflichtteilsansprüche beträgt drei Jahre. Sie beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Erbfall bekannt wurde und der Berechtigte wusste, dass er enterbt ist. Unabhängig davon gilt eine Höchstfrist von 30 Jahren ab Entstehung des Anspruchs (Erbfall). Danach erlischt der Anspruch endgültig.
Die Fristberechnung führt oft zu Missverständnissen, da nicht der Todestag entscheidend ist, sondern das Jahresende. So kann sich die Frist faktisch verlängern. Beispiel: Stirbt der Erblasser im März 2020, beginnt die Frist am 31.12.2020 und läuft bis Ende 2023.
- Regelverjährung: Drei Jahre ab Ende des Jahres der Kenntnis vom Erbfall und der Enterbung.
- Fristbeginn: Jahresende der Kenntnis (Stichtag jeweils 31.12.).
- Höchstfrist: 30 Jahre ab Erbfall, unabhängig von Kenntnis.
- Hemmung: insbesondere durch Verhandlungen (§ 203 BGB) sowie durch Mahnbescheid oder Klage (§ 204 BGB).
- Neubeginn: durch Anerkenntnis des Anspruchs (§ 212 BGB).
- Kein Hemmungstatbestand: Ein bloßes Auskunfts- oder Forderungsschreiben hemmt die Verjährung nicht.
Pflichtteilsanspruch rechtzeitig durchsetzen
Pflichtteilsberechtigte sollten ihre Ansprüche frühzeitig anmelden. Dazu gehört, die Erben schriftlich zur Auskunft über den Nachlass aufzufordern und die Pflichtteilshöhe zu berechnen. Kommt keine Einigung zustande, muss innerhalb der Verjährungsfrist Klage erhoben oder ein Mahnbescheid beantragt werden.
Wird die Frist versäumt, geht der Anspruch unwiderruflich verloren. Auch Verhandlungen mit den Erben können die Verjährung hemmen, sollten jedoch klar dokumentiert werden. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich anwaltliche Beratung, um keine Fristen zu versäumen.

Schenkungen und Pflichtteil – der Pflichtteilsergänzungsanspruch
Schenkungen des Erblassers zu Lebzeiten können den Pflichtteil beeinflussen. Nach § 2325 BGB haben enterbte Angehörige Anspruch auf Ergänzung ihres Pflichtteils, wenn der Erblasser in den letzten zehn Jahren größere Schenkungen vorgenommen hat. Der Wert der Schenkung wird dem Nachlass fiktiv hinzugerechnet und nach dem Abschmelzungsmodell anteilig berücksichtigt.
Was ist der Pflichtteilsergänzungsanspruch?
Der Pflichtteilsergänzungsanspruch schützt Pflichtteilsberechtigte vor Umgehungen durch lebzeitige Schenkungen. Hat der Erblasser Vermögen verschenkt, wird dieser Wert dem Nachlass anteilig zugerechnet. Dadurch erhöht sich der Pflichtteil, auch wenn das Vermögen tatsächlich nicht mehr vorhanden ist.
Die Grundlage ist § 2325 BGB: Innerhalb von zehn Jahren vor dem Tod gemachte Schenkungen sind relevant, wobei die Anrechnung mit jedem Jahr abnimmt. Damit wird verhindert, dass kurz vor dem Erbfall Vermögen entzogen wird, um Pflichtteile zu schmälern.
Anrechnung von Schenkungen – 10-Jahres-Abschmelzungsmodell
Für die Anrechnung gilt ein Abschmelzungsmodell: Im ersten Jahr vor dem Tod wird eine Schenkung zu 100 % berücksichtigt. Mit jedem weiteren Jahr verringert sich der Wert um 10 %. Nach Ablauf von zehn Jahren bleibt eine Schenkung unberücksichtigt. Schenkungen an Ehegatten oder mit Nießbrauchsvorbehalt haben Sonderregeln.
Diese Berechnung sorgt für Fairness: Frühere Schenkungen verlieren mit der Zeit an Bedeutung, kurzfristige Schenkungen werden aber voll einbezogen.
| Zeitspanne seit Schenkung | Anrechnungswert |
|---|---|
| bis 1 Jahr | 100 % |
| über 1 bis 2 Jahre | 90 % |
| über 2 bis 3 Jahre | 80 % |
| über 3 bis 4 Jahre | 70 % |
| über 4 bis 5 Jahre | 60 % |
| über 5 bis 6 Jahre | 50 % |
| über 6 bis 7 Jahre | 40 % |
| über 7 bis 8 Jahre | 30 % |
| über 8 bis 9 Jahre | 20 % |
| über 9 bis 10 Jahre | 10 % |
| mehr als 10 Jahre | 0 % |
Ausnahmen bei Schenkungen – was bleibt unberücksichtigt?
Nicht jede Zuwendung erhöht den Pflichtteil. Gesetzlich ausgenommen sind sogenannte Anstandsschenkungen, also übliche Geschenke zu Anlässen wie Geburtstagen oder Hochzeiten. Auch Schenkungen an Ehegatten sind besonders geregelt: Die Zehnjahresfrist beginnt während bestehender Ehe regelmäßig nicht zu laufen und setzt häufig erst mit Auflösung des Güterstands ein. Bei Schenkungen mit Vorbehaltsnießbrauch läuft die Frist ebenfalls nicht, solange der Schenker noch Nutzungsrechte behält.
Diese Ausnahmen stellen sicher, dass alltägliche oder formell unvollständige Schenkungen nicht zu einer unverhältnismäßigen Belastung der Erben führen.
Sie haben ein rechtliches Anliegen zum Erben und Vererben?

Mein Partner KLUGO verhilft Ihnen zu Ihrem Recht! Mit individuellen rechtlichen Lösungen und der persönlichen Beratung beim Rechtsexperten werden Ihre Fragen geklärt. Sie erfahren, welche Chancen und Risiken bestehen. Auf Wunsch können Sie den Rechtsanwalt im Anschluss direkt beauftragen.
- Soforthilfe bei Rechtsfragen: Ihre Situation, Ihre Chancen und Ihre Risiken
- Beratung durch erfahrene Anwälte & Rechtsexperten
- Ortsunabhängig, persönlich und digital
Häufig gestellte Fragen
Wie berechne ich meinen Pflichtteil, wenn der Erblasser in den letzten zehn Jahren große Schenkungen gemacht hat?
Müssen Kinder beim Berliner Testament sofort ihren Pflichtteil geltend machen, um später nicht leer auszugehen?
Verliert ein Ehegatte seinen Pflichtteilsanspruch automatisch bei laufender Scheidung?
Wie ermitteln Eltern zuverlässig den gesetzlichen Erbteil der Kinder bei Immobilien und Schulden?
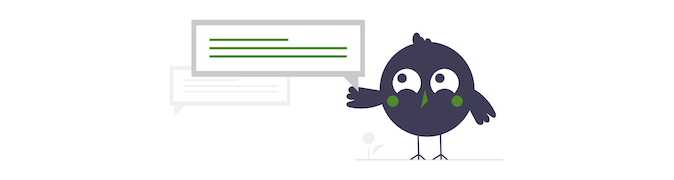
Toni | RECHNER.APP » Assistent
- Ihr digitaler Assistent für individuelle Fragen und verständliche Informationen. Die KI wertet alle Inhalte der Webseite aus und erklärt komplexe Themen einfach.
- Keine Anmeldung erforderlich.
- Kostenlos im Browser.



Quellenangaben und weiterführende Literatur
Die Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert und zusammengetragen. Folgende Quellen und weiterführende Literatur empfehle ich im Kontext Gesetzlicher Erbteil:
Dieser Beitrag wurde recherchiert und veröffentlicht von Dr. Stephan Seitz
Mein Name ist Dr. Stephan Seitz und ich betreibe RECHNER.APP. Ich habe an der LMU München Jura studiert, 2006 mein Staatsexamen abgelegt und anschließend an der Universität Regensburg promoviert. Mehr zu meinem Werdegang und beruflichen Stationen finden Sie bei Interesse auf LinkedIn.
Die Idee zu dieser Webseite entstand, als ich für meine erste Plattform HEREDITAS » Ratgeber Erbengemeinschaft praktische Online-Rechner entwickelt habe. Die positiven Rückmeldungen meiner Nutzer haben mich motiviert, das Angebot stetig zu erweitern. Heute finden Sie auf RECHNER.APP eine Vielzahl an Rechnern zu unterschiedlichen Anlässen – auch über das Erbrecht hinaus.
Meine Inhalte und die Online-Rechner sind für Sie kostenfrei. Mögliche Werbelinks, die zur Finanzierung beitragen, sind transparent gekennzeichnet.
Sie erreichen mich über die Kontaktseite.

Kommentare
Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!