Fristenrechner: Gesetzliche Fristen berechnen

Zuletzt aktualisiert:
Ihre Lesezeit:

Fristenrechner
- Fristenarten sind entscheidend für rechtliche Handlungen. Es gibt zwei Hauptarten von Fristen: Ereignisfristen, die ab einem bestimmten Ereignis beginnen, und Terminfristen, die ab einem festgelegten Datum starten. Das genaue Verständnis dieser Unterschiede ist unerlässlich, um rechtzeitig zu handeln.
- Die Fristberechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Beginn einer Frist kann durch Ereignisse oder festgelegte Stichtage bestimmt werden, und es ist wichtig, den richtigen Startpunkt zu wählen. Beispielsweise zählt der Tag eines Ereignisses nicht mit, während ein festgelegter Termin bereits als erster Tag gilt.
- Regionale Feiertage können die Fristberechnung beeinflussen. Da Feiertage von Bundesland zu Bundesland variieren, ist es wichtig, das zutreffende Bundesland auszuwählen, um alle relevanten Feiertage zu berücksichtigen. Dies kann entscheidend sein, um Fristen korrekt einzuhalten und rechtliche Nachteile zu vermeiden.

Inhaltsverzeichnis
- Fristenrechner: So funktioniert die Berechnung
- Definition Fristen und Termine nach BGB
- Berechnung des Fristbeginns bei gesetzlichen Fristen
- Berechnung des Fristendes bei gesetzlichen Fristen
- Ausnahmen, bei denen der Anfangstag mitzählt
- Besonderheiten bei Leistungserbringung und Willenserklärungen, wenn das Fristende auf Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt
- Ausweg bei Fristversäumnis: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand?
- Typische Anwendungsfälle für die Fristberechnung
Fristenrechner: So funktioniert die Berechnung
Zunächst wählen Sie die Art der Frist aus. Das kann eine Ereignisfrist oder eine Termin- bzw. Beginnfrist sein. Alternativ können Sie auch eine spezifische Frist, beispielsweise die Einspruchsfrist gegen einen Steuerbescheid oder die Erhebung einer Kündigungsschutzklage, angeben.
Ereignisfrist
Bei einer Ereignisfrist beginnt die Frist ab dem Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses. Der Zeitraum startet dabei erst am Tag nach diesem Geschehen, zum Beispiel dem Erhalt eines Schreibens oder der Bekanntgabe eines Bescheids. Um die Frist korrekt zu berechnen, ist das genaue Datum des zugrunde liegenden Ereignisses entscheidend.
Termin- oder Beginnfrist
Eine Termin- oder Beginnfrist startet ab einem im Voraus festgelegten Datum, etwa „ab dem 1. Mai“. In diesem Fall zählt bereits der erste Tag mit. Während sich bei der Ereignisfrist das Startdatum aus einem bestimmten Geschehen ergibt, ist die Beginnfrist häufig gesetzlich oder vertraglich geregelt und unabhängig von äußeren Ereignissen.
Dauer der Frist
Fristen können unterschiedlich bemessen sein und in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren angegeben werden. Nachfolgend einige Beispiele:
- Tagesfristen werden in Tagen bemessen, etwa eine 14-tägige Rückgabefrist nach dem Kauf eines Artikels.
- Wochenfristen werden in Wochen berechnet, zum Beispiel eine Kündigungsfrist von drei Wochen. Häufig endet eine Wochenfrist an dem Wochentag, der dem Fristbeginn entspricht.
- Monatsfristen werden in Monaten angegeben, etwa eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende. Hier endet die Frist an dem Tag des Endmonats, der dem Anfangstag entspricht. Gibt es diesen Tag im Endmonat nicht (z. B. 31. Februar), endet die Frist am letzten Tag dieses Monats.
- Jahresfristen laufen über volle Jahre, beispielsweise eine zweijährige Garantiezeit.
- Manche Fristen enden zum Ende eines Monats, Quartals, Halbjahres oder Jahres. Gerade im Geschäftsleben kommt es häufig vor, dass einheitlich zum Monats- oder Quartalsende abgerechnet wird.
Gesetzlich definiert ein halbes Jahr als sechs Monate, ein Vierteljahr als drei Monate und einen halben Monat als 15 Tage (§ 189 BGB). Nach § 192 BGB ist mit „Anfang des Monats“ der 1. Tag, mit „Mitte des Monats“ der 15. Tag und mit „Ende des Monats“ der letzte Tag des Monats gemeint.
Sobald Sie die Dauer der Frist festgelegt haben, wird der Beginn der Frist angegeben. Das kann das Datum eines Ereignisses (für Ereignisfristen) oder ein festgelegter Stichtag (für Terminfristen) sein.
Auswahl des Bundeslandes
Da Feiertage je nach Bundesland variieren und dies die Fristberechnung beeinflussen kann, wählen Sie bitte das zutreffende Bundesland aus. Auf diese Weise werden alle relevanten Feiertage korrekt berücksichtigt.
Übersicht über Fristarten
| Fristart | Beginn | Ende |
|---|---|---|
| Ereignisfrist | Am Tag nach dem Ereignis (z. B. Erhalt des Schreibens) | Ablauf des letzten Tages der Dauer (z. B. drei Wochen später um 24 Uhr) |
| Beginn- oder Terminfrist | Stichtag (z. B. "ab dem 1. Mai") zählt bereits mit | Ablauf des letzten Tags der Fristdauer (z. B. 30. Oktober bei sechs Monaten) |
| Wochen- und Monatsfristen | Analog Ereignis- oder Beginnfrist, abhängig von der gesetzlichen Regelung | Endet mit Ablauf des entsprechenden Wochentags bzw. Monatstags (ggf. Verschiebung nach § 193 BGB) |
Sie haben ein rechtliches Anliegen oder benötigen einen Anwalt?

Mein Partner KLUGO verhilft Ihnen zu Ihrem Recht! Mit individuellen rechtlichen Lösungen und der persönlichen Beratung beim Rechtsexperten werden Ihre Fragen geklärt. Sie erfahren, welche Chancen und Risiken bestehen. Auf Wunsch können Sie den Rechtsanwalt im Anschluss direkt beauftragen.
- Soforthilfe bei Rechtsfragen: Ihre Situation, Ihre Chancen und Ihre Risiken
- Beratung durch erfahrene Anwälte & Rechtsexperten
- Ortsunabhängig, persönlich und digital
Definition Fristen und Termine nach BGB
Eine Frist ist ein abgegrenzter Zeitraum mit definiertem Anfang und Ende. Im BGB wird zwischen Ereignisfristen und Beginn- oder Terminfristen unterschieden (§ 187 BGB). Die Ereignisfrist beginnt erst am Tag nach einem bestimmten Ereignis, während bei einer Termin- oder Beginnfrist der maßgebliche Tag bereits mitzählt.
Ein Termin hingegen ist ein genauer Zeitpunkt, an dem etwas rechtlich Relevantes geschieht. Ist dabei der Beginn eines Tages entscheidend, wird dieser Tag bei der Fristberechnung einbezogen (§ 187 Abs. 2 BGB).
Eine Frist kann verschiedene Zwecke erfüllen:
- Sie kann Rechte begründen. Mit einer Ersitzungsfrist von zehn Jahren (§ 937 BGB) werden Sie beispielsweise Eigentümer einer beweglichen Sache, wenn Sie diese ununterbrochen in eigenem Besitz haben.
- Fristen können Rechte erlöschen lassen. Wenn eine gesetzliche Verjährungsfrist versäumt wird, verfällt ein Zahlungsanspruch.
- Umgekehrt können Fristen auch Rechte begründen, etwa wenn Sie sich im richtigen Moment auf die Verjährung berufen.
- Fristen können auf Gesetz, gerichtlicher Anordnung oder einer vertraglichen Vereinbarung beruhen.
- Die Dauer einer Frist kann teils durch unbestimmte Rechtsbegriffe wie „unverzüglich“ oder „ohne schuldhaftes Zögern“ nach § 121 BGB bestimmt sein.
- Manche Fristen beginnen erst, wenn Sie von etwas Kenntnis erlangen. So läuft die Ausschlagungsfrist von sechs Wochen im Erbfall erst ab dem Zeitpunkt, an dem Sie erfahren, dass Sie Erbe oder Erbin sind.
Berechnung des Fristbeginns bei gesetzlichen Fristen
Wenn eine Frist an ein bestimmtes Ereignis oder einen Zeitpunkt im Lauf eines Tages anknüpft, wird der Tag des Ereignisses nicht in die Frist einbezogen (§ 187 Abs. 1 BGB). Der folgende Tag gilt dann als erster Tag der Frist. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieser Tag auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt. Wird in einer Vereinbarung eine Frist „ab heute“ bemessen, zählt das „heute“ nicht mit.
Liegt der Beginn eines Tages zugrunde, wird dieser Tag mitgezählt (§ 187 Abs. 2 BGB). Das gilt zum Beispiel für vertraglich oder gesetzlich festgelegte Stichtage, wie „ab dem 1. Mai“.
Der Gesetzestext ist nicht einfach verständlich. Trotzdem gibt es bei verpassten Fristen keine Gnade, es drohen unmittelbar Nachteile. Mein Online-Rechner hilft Ihnen bei der exakten Bestimmung von Fristbeginn und Fristende.

Persönlicher Experten-Tipp von Dr. Stephan Seitz
Berechnung des Fristendes bei gesetzlichen Fristen
Ist eine Frist in Tagen bemessen, endet sie mit Ablauf des letzten Tages um 24 Uhr (§ 188 Abs. 1 BGB). Bei einer Monatsfrist endet die Frist mit Ablauf des letzten Tages des betreffenden Monats. Beginnt eine Monatsfrist zum Beispiel am 31. Januar, so endet sie am 28. Februar (oder am 29. Februar in einem Schaltjahr). Wird die Frist am 28. Februar ausgelöst, endet sie am 28. März und nicht am 31. März.
 Fristenrechner: Meine weiteren Artikel
Fristenrechner: Meine weiteren Artikel
 Testament anfechten Frist: Jetzt berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Testament anfechten Frist: Jetzt berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 18. Februar 2025 Bußgeldbescheid Frist: Jetzt berechnen!Autor: Dr. Stephan Seitz
Bußgeldbescheid Frist: Jetzt berechnen!Autor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 18. Februar 2025 Einspruchsfrist Steuerbescheid: Frist jetzt berechnen!Autor: Dr. Stephan Seitz
Einspruchsfrist Steuerbescheid: Frist jetzt berechnen!Autor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 19. Februar 2025 Frist Erbe ausschlagen: Gesetzliche Frist berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Frist Erbe ausschlagen: Gesetzliche Frist berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 19. Februar 2025 Gesetzliche Gewährleistungsfrist: Beginn und Ende berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Gesetzliche Gewährleistungsfrist: Beginn und Ende berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 19. Februar 2025
Ausnahmen, bei denen der Anfangstag mitzählt
Der Anfangstag wird mitgezählt, wenn die Frist mit Tagesanfang beginnt oder wenn das Lebensalter berechnet wird (§ 187 Abs. 2 BGB). In diesen Fällen ist der erste Tag selbst bereits Teil der Frist.
- Ein Kaufmann pachtet ein Ladenlokal ab dem 1. Mai. Mit diesem Tag startet auch die Kündigungsfrist.
- Wer am 1. Mai 2000 geboren ist, zählt den 1. Mai bei der Lebensaltersberechnung mit, sodass ab Mitternacht dieses Tages ein weiteres Lebensjahr beginnt.
- Geburtstage am Monatsersten führen dazu, dass das neue Lebensjahr bereits ab 0 Uhr dieses Tages erreicht wird. Wer am 1. Juli geboren ist, wird also bereits zum Beginn des 1. Juli ein Jahr älter.
- Wer in einem Schaltjahr am 29. Februar geboren ist, wird in Nichtschaltjahren rechtlich so behandelt, als habe diese Person am 1. März Geburtstag (§ 188 Abs. 2 BGB).
- Gesetze, die am Tag ihrer Verkündung in Kraft treten, gelten ab diesem Tag.
- In manchen Spezialgesetzen ist ausdrücklich geregelt, dass der erste Tag einer Frist mitzählt, etwa wenn dieser Tag als Stichtag angegeben ist.
Besonderheiten bei Leistungserbringung und Willenserklärungen, wenn das Fristende auf Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt
In vielen Rechtsbereichen bestehen Fristen, innerhalb derer Handlungen vorgenommen oder Erklärungen abgegeben werden müssen. Das Fristende entscheidet darüber, ob eine Handlung noch rechtzeitig erfolgt. Dabei ist zu unterscheiden, ob es um eine Leistung oder um eine Willenserklärung geht.
Eine Leistung ist eine bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens, wie etwa eine Zahlung oder die Übergabe einer Sache. Eine Willenserklärung ist eine Erklärung, mit der jemand einen rechtlich relevanten Erfolg beabsichtigt, zum Beispiel eine Klageerhebung oder einen Einspruch.
§ 193 BGB schützt davor, dass der letzte Tag einer Frist auf einen arbeitsfreien Tag (Samstag, Sonntag oder Feiertag) fällt und so für die abgebende Person unzumutbar wird. Dies betrifft jedoch nicht alle Fristen, etwa vertragliche Kündigungsfristen, bei denen oft eine Mindestfrist zugunsten der anderen Partei gilt.
Fällt das Fristende für eine maßgebliche Handlung auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag um 24 Uhr. Das gilt allerdings nur für Fristen, die noch eine aktive Handlung oder Erklärung erfordern. Ob ein regionaler Feiertag die Frist verlängert, richtet sich danach, wo die Handlung vorzunehmen ist.

Ausweg bei Fristversäumnis: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand?
Wenn Sie eine Frist versäumt haben, kann in bestimmten Fällen ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand helfen.
Dieses Verfahren ermöglicht es, prozessuale Rechte nachträglich wiederzuerlangen, sofern die Frist ohne eigenes Verschulden versäumt wurde, etwa aufgrund von Krankheit oder Problemen bei der Zustellung. Der Antrag ist unverzüglich zu stellen, sobald das Hindernis entfällt. Er muss mit geeigneten Belegen begründet werden. Wird der Wiedereinsetzung stattgegeben, gilt die Frist als gewahrt, als wäre sie nie versäumt worden.
Die konkrete Frist für die Wiedereinsetzung kann je nach Rechtsgebiet (Zivilprozess, Steuerrecht, Bußgeldverfahren) variieren und sollte im Einzelfall geprüft werden.
Typische Anwendungsfälle für die Fristberechnung
In der Praxis begegnen Ihnen zahlreiche Situationen, in denen Fristen eine Rolle spielen. Wer sich überlegt, ob eine Klage eingereicht, ein Widerruf erklärt oder ein Vertrag gekündigt werden soll, muss genau wissen, wann die Frist beginnt und wann sie endet. Nachfolgend einige Beispiele, bei denen ein Fristenrechner BGB besonders hilfreich sein kann.
2-Wochen-Frist bei Widerruf oder Widerspruch
Beim Kauf im Internet oder an der Haustür ist häufig eine 14-tägige Widerrufsfrist vorgesehen. Möchten Sie diese 2 Wochen Frist berechnen, sollten Sie genau das Datum des Vertragsschlusses (Ereignis) ermitteln und den darauffolgenden Tag als Beginnfrist ansetzen, falls es sich um eine Ereignisfrist handelt.
Wochenfrist bei Kündigungsschutzklage
Wer vom Arbeitgeber eine Kündigung erhält, hat in der Regel drei Wochen Zeit, eine Kündigungsschutzklage einzureichen. Um diese Wochenfrist berechnen zu können, ist es essenziell, den Tag der Zustellung des Kündigungsschreibens zu kennen. Der darauffolgende Tag bildet dann den Fristbeginn. Sollten Sie einmal unsicher sein, ob Wochenenden oder gesetzliche Feiertage die Fristenberechnung beeinflussen, kann ein Fristenrechner Tage dabei helfen, die genaue Laufzeit bis zum Fristende zu bestimmen.
Monatsfrist bei Mietverträgen
Gerade bei Wohnraummietverträgen spielt die Monatsfrist für Kündigungen eine wichtige Rolle. Wer zum Beispiel zum Monatsende kündigen möchte, muss sicherstellen, dass das Kündigungsschreiben rechtzeitig zugeht. Um eine Monatsfrist berechnen zu können, können Sie das genaue Zugangsdatum als Startpunkt wählen. Ein Onlinerechner berechnet anschließend den letzten Tag der Frist unter Berücksichtigung von Wochenenden und Feiertagen.
Kurzfristige Fristen von wenigen Tagen
Manchmal bleibt nur ein sehr kurzer Zeitraum von drei, fünf oder sieben Tagen, etwa bei Abmahnungen. Hierbei kann es schnell zu Fehlern kommen, wenn Sie Feiertage oder Samstage unberücksichtigt lassen. Mit einem Fristenrechner BGB stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Tage im Blick behalten.
Sie haben ein rechtliches Anliegen oder benötigen einen Anwalt?

Mein Partner KLUGO verhilft Ihnen zu Ihrem Recht! Mit individuellen rechtlichen Lösungen und der persönlichen Beratung beim Rechtsexperten werden Ihre Fragen geklärt. Sie erfahren, welche Chancen und Risiken bestehen. Auf Wunsch können Sie den Rechtsanwalt im Anschluss direkt beauftragen.
- Soforthilfe bei Rechtsfragen: Ihre Situation, Ihre Chancen und Ihre Risiken
- Beratung durch erfahrene Anwälte & Rechtsexperten
- Ortsunabhängig, persönlich und digital
Häufig gestellte Fragen
Wie berechne ich eine Frist, die an ein Ereignis gebunden ist?
Was passiert, wenn das Fristende auf einen Feiertag fällt?
Kann ich eine versäumte Frist nachträglich wiederherstellen?
Wie funktioniert die Berechnung einer Monatsfrist?
Wie kann ein Fristenrechner helfen?
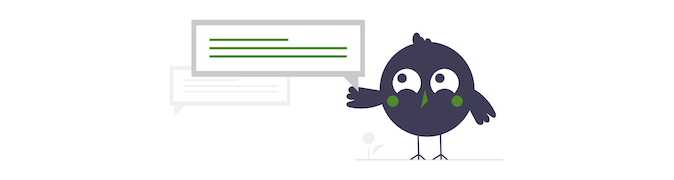
Toni | RECHNER.APP » Assistent
- Ihr digitaler Assistent für individuelle Fragen und verständliche Informationen. Die KI wertet alle Inhalte der Webseite aus und erklärt komplexe Themen einfach.
- Keine Anmeldung erforderlich.
- Kostenlos im Browser.



Quellenangaben und weiterführende Literatur
Die Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert und zusammengetragen. Folgende Quellen und weiterführende Literatur empfehle ich im Kontext Fristenrechner:
Dieser Beitrag wurde recherchiert und veröffentlicht von Dr. Stephan Seitz
Mein Name ist Dr. Stephan Seitz und ich betreibe RECHNER.APP. Ich habe an der LMU München Jura studiert, 2006 mein Staatsexamen abgelegt und anschließend an der Universität Regensburg promoviert. Mehr zu meinem Werdegang und beruflichen Stationen finden Sie bei Interesse auf LinkedIn.
Die Idee zu dieser Webseite entstand, als ich für meine erste Plattform HEREDITAS » Ratgeber Erbengemeinschaft praktische Online-Rechner entwickelt habe. Die positiven Rückmeldungen meiner Nutzer haben mich motiviert, das Angebot stetig zu erweitern. Heute finden Sie auf RECHNER.APP eine Vielzahl an Rechnern zu unterschiedlichen Anlässen – auch über das Erbrecht hinaus.
Meine Inhalte und die Online-Rechner sind für Sie kostenfrei. Mögliche Werbelinks, die zur Finanzierung beitragen, sind transparent gekennzeichnet.
Sie erreichen mich über die Kontaktseite.

Kommentare
Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!