Erbschaftssteuer Höhe verstehen: Wer zahlt wie viel?

Zuletzt aktualisiert:
Ihre Lesezeit:
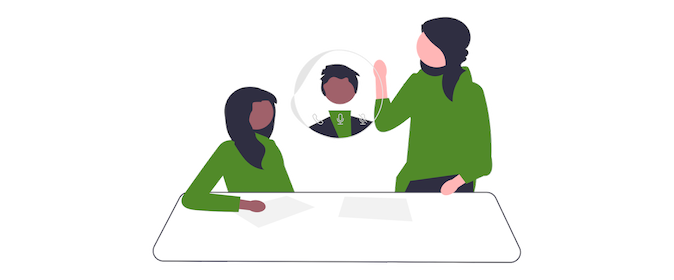
Erbschaftssteuer Höhe
- Steuerpflichtiger Erwerb ist die Bemessungsgrundlage: Der steuerpflichtige Erwerb ergibt sich aus dem Wert des Nachlasses abzüglich des persönlichen Freibetrags; nur der darüber hinausgehende Betrag wird besteuert. Auf diesen Restbetrag wird je nach Steuerklasse ein gestaffelter Prozentsatz nach § 19 ErbStG angewandt. Beispiel: Erben Sie 500.000 € und haben 400.000 € Freibetrag, sind 100.000 € steuerpflichtig.
- Steuerklasse und Freibetrag entscheiden über die Belastung: Die Einordnung in Steuerklasse I, II oder III bestimmt sowohl den Freibetrag als auch den anzuwendenden Steuersatz, sodass nahe Angehörige deutlich geringere Belastungen haben. Ehegatten erhalten z. B. 500.000 € Freibetrag, Kinder 400.000 €, übrige Erben häufig nur 20.000 €, und die Sätze reichen je nach Klasse von etwa 7 % bis 50 %. Daher kann bei gleichem Erbwert der zu zahlende Steuerbetrag stark variieren.
- Immobilienbewertung, Familienheim-Regelung und Abzüge reduzieren die Steuerbasis: Immobilien werden zum gemeinen Wert angesetzt; vermietete Wohnobjekte können steuerlich oft nur zu 90 % berücksichtigt werden (§ 13d ErbStG), und ein selbstgenutztes Familienheim kann unter Voraussetzungen steuerfrei übergehen (Eigennutzung, Bindungsfristen, 200‑m²‑Grenze für Kinder). Zudem mindern Nachlassverbindlichkeiten sowie Bestattungs- und Nachlasskosten die Bemessungsgrundlage; das Finanzamt erkennt pauschal 15.000 € an oder höhere Beträge mit Belegen. Diese Regelungen können die zu zahlende Erbschaftssteuer erheblich senken.

Inhaltsverzeichnis
- Erbschaftssteuer Höhe berechnen: So funktioniert es
- Steuerklassen und Steuersätze bei der Erbschaftssteuer
- Freibeträge bei Erbschaften (inklusive Versorgungsfreibetrag)
- Immobilien im Erbe: Bewertung und Familienheim-Regelung
- Weitere Steuerbefreiungen und abzugsfähige Nachlasskosten
- Erbschaftssteuer legal senken – Strategien
- Besondere Fälle: Erbengemeinschaft, Betriebsvermögen, Tarifgrenzen
Erbschaftssteuer Höhe berechnen: So funktioniert es
Die Erbschaftssteuer Höhe ergibt sich aus dem steuerpflichtigen Erwerb: Vom Wert des Nachlasses wird der persönliche Freibetrag abgezogen; auf den verbleibenden Betrag greift der Steuersatz nach Steuerklasse (§§ 16, 19 ErbStG). Dadurch zahlen nahe Angehörige oft weniger oder gar nichts, während entfernte Erben höhere Sätze und niedrigere Freibeträge haben.
Berechnungsgrundlage: Erbschaftssteuer Höhe verstehen
Der steuerpflichtige Erwerb ist die Basis der Besteuerung: Nachlasswert minus persönlicher Freibetrag ergibt die Bemessungsgrundlage; anschließend wird je nach Steuerklasse der passende Steuersatz angewandt. Nur der Teil oberhalb des Freibetrags ist überhaupt steuerpflichtig. Wohnsitz und Inlandsvermögen können für die Steuerpflicht relevant sein; Details zu Freibeträgen, Steuerklassen und Stufensätzen folgen in den nächsten Kapiteln, hier geht es um das Grundprinzip.
Für die Berechnung zählen alle Vermögenswerte des Erblassers (z. B. Geld, Wertpapiere, Immobilien). Nachlassverbindlichkeiten und bestimmte Kosten (z. B. Beerdigung) mindern den ansetzbaren Wert. Ergebnis: Erst wenn der bereinigte Nachlass den Freibetrag übersteigt, fällt auf den überschießenden Betrag ein gestaffelter Prozentsatz nach § 19 ErbStG an – so entsteht Ihre endgültige Erbschaftssteuer Höhe.
Schnell schätzen mit Tool: RECHNER.APP Erbschaftssteuer Online-Rechner
Mit dem RECHNER.APP Erbschaftssteuer Online-Rechner erhalten Sie in Sekunden eine belastbare Schätzung: Erbwert eingeben, Verwandtschaft/Steuerklasse wählen, bereits erhaltene Schenkungen innerhalb von zehn Jahren berücksichtigen – der korrekte Freibetrag wird automatisch abgezogen und die voraussichtliche Steuer gestaffelt angezeigt.
- Erbwert ermitteln: Summieren Sie Geld, Wertpapiere und Immobilienwerte (bei Immobilien zunächst grob den Verkehrswert ansetzen).
- Steuerklasse bestimmen: Leiten Sie diese aus dem Verwandtschaftsgrad ab (I, II, III – beeinflusst Freibetrag und Prozentsätze).
- Freibetrag abziehen: Nur der Betrag oberhalb des Freibetrags ist steuerpflichtig; Kosten und Schulden mindern zusätzlich.
- Staffelsatz anwenden: Auf den steuerpflichtigen Rest greift die passende Stufe nach § 19 ErbStG; das Tool berechnet die Stufe automatisch.
Steuererklärung online machen und ∅ 1.328 € kassieren!

- Teure Berater sparen und Steuererklärung selbst machen. Schritt für Schritt per Interview.
- Dank Live-Berechnung sehen Sie sofort, wie viel Geld Sie später vom Staat zurückbekommen.
- Mehrfach getestet und für sehr gut befunden.
Steuerklassen und Steuersätze bei der Erbschaftssteuer
Die Steuerklasse bestimmt, wie hoch der Steuersatz in der Erbschaftssteuer ausfällt. Enge Angehörige (Steuerklasse I) zahlen zwischen 7 und 30 %, entferntere Verwandte (Steuerklasse II) zwischen 15 und 43 %. Nicht-Verwandte (Steuerklasse III) müssen je nach Erbwert bis zu 50 % an Erbschaftssteuer entrichten.
Verwandtschaftsgrad und Steuerklassen (I, II, III)
Die Einordnung in eine Steuerklasse richtet sich nach dem Verwandtschaftsgrad. Steuerklasse I umfasst Ehepartner, Kinder, Enkel, Urenkel und in bestimmten Fällen auch Eltern oder Großeltern. Steuerklasse II gilt u. a. für Geschwister, Nichten, Neffen, Stiefeltern oder geschiedene Ehepartner. Steuerklasse III erfasst alle übrigen Erben wie Lebensgefährten ohne Trauschein oder Freunde – sie trifft die höchste Steuerlast.
Die Steuerklasse wirkt sich doppelt aus: Sie bestimmt sowohl die Höhe des Freibetrags als auch den Prozentsatz der Besteuerung. Dadurch zahlen nahe Angehörige oft gar keine Steuer, während entferntere Verwandte und Fremde schon bei kleinen Erbsummen stark belastet werden.
- Steuerklasse I: Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Kinder, Stiefkinder, Enkel, Urenkel, Eltern/Großeltern beim Erbe von Kindern.
- Steuerklasse II: Geschwister, Nichten, Neffen, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, geschiedene Ehegatten, Stiefeltern.
- Steuerklasse III: Alle übrigen Personen ohne direkte Verwandtschaft (z. B. Lebensgefährten ohne Ehe, entfernte Bekannte, Freunde).
Steuersatz-Stufen nach § 19 ErbStG
Die Höhe der Erbschaftssteuer richtet sich nicht nur nach der Steuerklasse, sondern auch nach der Wertstufe des steuerpflichtigen Erbes. Für jede Stufe gelten feste Prozentsätze, die von 7 % bis 50 % reichen. Dabei wird der gesamte steuerpflichtige Betrag mit dem Satz der erreichten Stufe belegt – Grenzübertritte können daher zu deutlichen Steuerunterschieden führen, die durch einen Härtefallausgleich abgemildert werden.
| Wert des steuerpflichtigen Erbes | Steuersatz Klasse I | Steuersatz Klasse II | Steuersatz Klasse III |
|---|---|---|---|
| bis 75.000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
| bis 300.000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
| bis 600.000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
| bis 6.000.000 € | 19 % | 30 % | 30 % |
| bis 13.000.000 € | 23 % | 35 % | 50 % |
| bis 26.000.000 € | 27 % | 40 % | 50 % |
| über 26.000.000 € | 30 % | 43 % | 50 % |
Freibeträge bei Erbschaften (inklusive Versorgungsfreibetrag)
Freibeträge bestimmen, wie viel Vermögen steuerfrei vererbt werden kann. Sie richten sich nach dem Verwandtschaftsgrad: Ehepartner dürfen 500.000 €, Kinder 400.000 € und Enkel bis zu 200.000 € steuerfrei erhalten. Erst der Teil, der diese Freibeträge übersteigt, unterliegt der Erbschaftssteuer.
Persönliche Freibeträge nach Verwandtschaftsgrad
Die Freibeträge sind im § 16 ErbStG geregelt und gelten für jede Erbschaft einzeln. Ehepartner und Kinder erhalten die höchsten Freibeträge, während entfernte Verwandte oder Nicht-Verwandte meist nur 20.000 € steuerfrei erben können. Dadurch entscheidet der Verwandtschaftsgrad oft darüber, ob überhaupt eine Steuer anfällt.
| Verwandtschaftsverhältnis | Freibetrag |
|---|---|
| Ehegatte / eingetragener Lebenspartner | 500.000 € |
| Kind (leiblich, adoptiert, Stiefkind) | 400.000 € |
| Enkelkind (wenn Elternteil noch lebt) | 200.000 € |
| Enkelkind (wenn Elternteil verstorben) | 400.000 € |
| Eltern und Großeltern (Erbfall von Kindern) | 100.000 € |
| Alle übrigen Erben (z. B. Geschwister, Freunde) | 20.000 € |
Besonderer Versorgungsfreibetrag für Ehepartner und Kinder
Zusätzlich zum persönlichen Freibetrag gibt es nach § 17 ErbStG einen Versorgungsfreibetrag. Er soll Ehepartnern und jungen Kindern finanzielle Sicherheit geben. Der Ehepartner hat Anspruch auf 256.000 €, Kinder je nach Alter zwischen 52.000 € und 10.300 €.
- Ehegatte/Lebenspartner: 256.000 € zusätzlich steuerfrei.
- Kind bis 5 Jahre: 52.000 €.
- Kind 5–10 Jahre: 41.000 €.
- Kind 10–15 Jahre: 30.700 €.
- Kind 15–20 Jahre: 20.500 €.
- Kind 20–27 Jahre: 10.300 €.
Freibeträge alle zehn Jahre neu nutzen
Schenkungen und Erbschaften werden für die Berechnung zusammengerechnet, wenn sie innerhalb von zehn Jahren von derselben Person stammen. Nach Ablauf dieser Frist erneuert sich der Freibetrag: So können Eltern ihren Kindern mehrfach 400.000 € steuerfrei übertragen, wenn sie die Zeitabstände beachten. Das gilt gleichermaßen für Schenkungen wie für Erbschaften.
- 0 Jahre: Eltern schenken dem Kind 400.000 € steuerfrei.
- 11 Jahre später: Beim Tod des Elternteils greift der Freibetrag von 400.000 € erneut.
Immobilien im Erbe: Bewertung und Familienheim-Regelung
Geerbte Immobilien spielen bei der Erbschaftsteuer eine große Rolle. Maßgeblich ist der gemeine Wert zum Zeitpunkt des Erbfalls, der regelmäßig über Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwertverfahren ermittelt wird. Vermietete Wohnimmobilien werden nach § 13d ErbStG nur zu 90 % ihres gemeinen Werts angesetzt; das senkt den steuerpflichtigen Erwerb deutlich.
Wertermittlung geerbter Immobilien (gemeiner Wert & 90 %-Regel)
Für die Besteuerung ist der gemeine Wert ausschlaggebend – also der Preis, der bei einer Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr erzielbar wäre. Das Finanzamt nutzt hierzu anerkannte Verfahren (Vergleichswert, Ertragswert, Sachwert) und setzt bei vermieteten Wohnimmobilien nach § 13d ErbStG nur 90 % an. Dadurch reduziert sich die Bemessungsgrundlage für die Erbschaftsteuer.
Die Verfahren unterscheiden sich je nach Objektart: Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser werden häufig im Vergleichswert, Mietobjekte im Ertragswert und spezielle Immobilien im Sachwert bewertet. Für selbstgenutzten Wohnraum gelten besondere Befreiungsregelungen, die nachfolgend erläutert werden.
- Vergleichswertverfahren: Marktpreise ähnlicher Immobilien dienen als Maßstab.
- Ertragswertverfahren: Der Wert leitet sich aus nachhaltig erzielbaren Mieten ab.
- Sachwertverfahren: Bau- und Bodenwerte bestimmen den objektspezifischen Sachwert.
Steuerbefreiung fürs Familienheim (Eigennutzung)
Ein selbstgenutztes Familienheim kann für Ehepartner und Kinder steuerfrei übergehen. Erforderlich ist, dass der Erblasser das Objekt bis zuletzt zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat; bei zwingenden Gründen wie Pflegebedürftigkeit bleibt die Befreiung auch beim vorherigen Auszug erhalten. Der Erwerber muss das Objekt unverzüglich zur Eigennutzung bestimmen; die in der Praxis oft genannte Sechs-Monats-Frist ist eine Orientierung der Rechtsprechung, jedoch keine starre Grenze.
Ehegatten müssen das Familienheim grundsätzlich zehn Jahre selbst bewohnen; bei Kindern gilt zusätzlich die 200-m²-Grenze: Nur der Anteil bis 200 m² bleibt steuerfrei, der darüber hinausgehende Teil ist anteilig steuerpflichtig. Aufgabe der Eigennutzung innerhalb von zehn Jahren führt regelmäßig zur Nachversteuerung – Ausnahmen gelten bei zwingenden Gründen (z. B. Krankheit).
- Eigennutzung beim Erblasser: Bis zum Erbfall zu Wohnzwecken genutzt; Ausnahmen bei Pflegebedürftigkeit.
- Unverzügliche Eigennutzungsbestimmung: Zügiger Einzug bzw. zeitnahe Bestimmung; keine starre 6-Monats-Frist.
- 10-Jahres-Bindung: Fortführung der Eigennutzung, sonst Nachversteuerung (außer bei zwingenden Gründen).
- 200-m²-Grenze (Kinder): Bis 200 m² steuerfrei; Mehrfläche anteilig steuerpflichtig.
 Erbschaftssteuer Höhe: Meine weiteren Artikel
Erbschaftssteuer Höhe: Meine weiteren Artikel
 Erbschaftssteuer Immobilien berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbschaftssteuer Immobilien berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 12. September 2025 Erbschaftssteuer Kind berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbschaftssteuer Kind berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 28. Mai 2025 Erbschaftssteuer Tabelle: Schnell mit Online-RechnerAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbschaftssteuer Tabelle: Schnell mit Online-RechnerAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 12. September 2025 Erbschaftssteuer berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbschaftssteuer berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 28. Mai 2025 Erbschaftssteuer Ehegatte berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Erbschaftssteuer Ehegatte berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 28. Mai 2025
Weitere Steuerbefreiungen und abzugsfähige Nachlasskosten
Neben Freibeträgen und Immobilienvergünstigungen gibt es weitere Entlastungen. Dazu gehören steuerfreie Sachwerte wie Hausrat oder Kunstgegenstände sowie die Möglichkeit, bestimmte Kosten und Schulden vom Nachlass abzuziehen. So sinkt der steuerpflichtige Erwerb und damit die Erbschaftssteuer Höhe.
Steuerfreie Sachwerte, Hausrat und Kunstgegenstände
Bestimmte bewegliche Dinge des täglichen Lebens sind steuerlich begünstigt. In Steuerklasse I sind Hausrat bis 41.000 € und weitere Gegenstände bis 12.000 € steuerfrei. In den Steuerklassen II und III gelten insgesamt 12.000 € für Hausrat und bewegliche Sachen zusammen. Zusätzlich können Kunst, wissenschaftliche Sammlungen oder Archive bis zu 60 % steuerbefreit sein, wenn sie kulturell bedeutend und zugänglich sind.
- Hausrat (Klasse I): bis 41.000 € steuerfrei.
- Andere bewegliche Dinge (Klasse I): bis 12.000 € steuerfrei.
- Hausrat + bewegliche Dinge (Klasse II/III): zusammen bis 12.000 € steuerfrei.
- Kunst/Sammlungen: 60 % Befreiung unter besonderen Voraussetzungen.
Nachlassverbindlichkeiten und Bestattungskosten abziehen
Vom Wert des Nachlasses dürfen bestimmte Kosten abgezogen werden. Dazu zählen Bestattung, Grabpflege und Verwaltungskosten. Das Finanzamt erkennt pauschal 15.000 € an, auch wenn die tatsächlichen Kosten geringer sind. Sind die Ausgaben höher, können Sie den vollen Betrag mit Belegen geltend machen. Zusätzlich mindern offene Schulden des Erblassers den steuerpflichtigen Erwerb.
- Beerdigungs- und Grabkosten: Trauerfeier, Grabstein, Grabpflege.
- Nachlassabwicklung: Kosten für Erbschein, Notar oder Testamentseröffnung.
- Schulden des Erblassers: z. B. Kredite, Hypotheken, offene Rechnungen.
- Pauschbetrag: 15.000 € ohne Nachweis, höherer Abzug mit Belegen möglich.
Erbschaftssteuer legal senken – Strategien
Mit rechtzeitiger Planung lassen sich Steuerlasten spürbar reduzieren. Besonders wirksam sind Schenkungen zu Lebzeiten, die steuerfreien Freibeträge mehrfach nutzen. Aber auch Ehe, kluges Testament oder die gezielte Nutzung der Familienheim-Regelung helfen, die Erbschaftssteuer Höhe zu senken.
Steuer sparen durch frühzeitige Schenkungen
Schenkungen gelten steuerlich wie Erbschaften, unterliegen aber denselben Freibeträgen. Das Besondere: Freibeträge erneuern sich alle zehn Jahre. Wer frühzeitig Vermögen überträgt, kann mehrfach 400.000 € an jedes Kind oder 500.000 € an den Ehepartner steuerfrei weitergeben. Dadurch schrumpft der spätere Nachlass und die Steuerlast sinkt erheblich.
- Freibeträge mehrfach nutzen: Alle 10 Jahre können erneut große Summen steuerfrei übertragen werden.
- Vermögen schrittweise übertragen: So vermeiden Sie hohe Steuerlast auf einmalige große Erbschaften.
- Schenkungen mit Auflagen: Wohnrecht oder Nießbrauch können den steuerlichen Wert mindern und zugleich Sicherheit für den Schenker bieten.
Weitere Gestaltungstipps zur Reduzierung der Erbschaftssteuer
Auch außerhalb von Schenkungen gibt es wirksame Möglichkeiten, die Steuerlast zu verringern. Eine Heirat verschafft dem Partner sofort Steuerklasse I mit 500.000 € Freibetrag. Ein durchdachtes Testament verteilt Vermögen so, dass Freibeträge mehrerer Personen genutzt werden. Zudem kann das Familienheim gezielt einem nahen Angehörigen übertragen werden, der es selbst bewohnt – dann bleibt es steuerfrei.
- Heirat oder Adoption: Steuerklasse I bringt hohe Freibeträge und günstige Steuersätze.
- Familienheim nutzen: Übertragung auf Ehepartner oder Kinder, die selbst einziehen, macht das Haus steuerfrei.
- Testament strategisch aufsetzen: Verteilung auf mehrere Erben sichert mehrere Freibeträge.
- Schenkungen vorziehen: Große Vermögen besser zu Lebzeiten portionsweise übertragen.
- Beratung einholen: Fachanwälte und Steuerberater entwickeln individuelle Lösungen, z. B. über Familiengesellschaften oder Stiftungen.
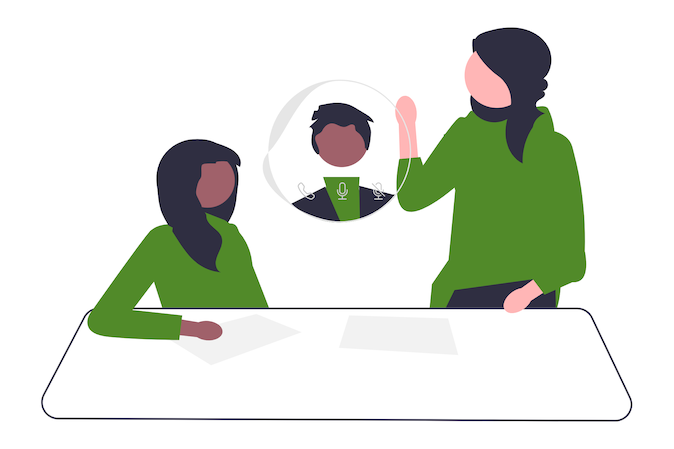
Besondere Fälle: Erbengemeinschaft, Betriebsvermögen, Tarifgrenzen
Neben Standardfällen gibt es Konstellationen mit besonderen Regeln. Dazu zählen die Besteuerung in der Erbengemeinschaft, weitreichende Verschonungen für Betriebsvermögen sowie der Ausgleich von Tarifsprüngen. Diese Punkte sind für die Praxis oft entscheidend.
Erbengemeinschaft – Erklärung und Zahlung
Jeder Erwerber wird nach § 20 Abs. 1 ErbStG getrennt besteuert und ist selbst Steuerschuldner. Mehrere Erben dürfen nach § 31 Abs. 4 ErbStG eine gemeinsame Erbschaftsteuererklärung abgeben; rechtlich bleibt jedoch jeder für seine eigene Steuer verantwortlich. Der Nachlass haftet bis zur Auseinandersetzung zusätzlich für die Erbschaftsteuer (§ 20 Abs. 3 ErbStG).
In der Praxis wird die Steuer häufig aus Nachlassmitteln beglichen, etwa bevor der Nachlass verteilt wird. Rechtlich schuldet die Steuer jedoch stets der jeweilige Erwerber; eine gesamtschuldnerische Haftung der Erben untereinander folgt daraus nicht.
- Getrennte Besteuerung: Jeder Erbe versteuert seinen Erwerb individuell.
- Gemeinsame Erklärung möglich: Eine einheitliche Abgabe erleichtert die Abwicklung.
- Nachlasshaftung: Der Nachlass haftet bis zur Teilung zusätzlich für die Steuer.
- Praktische Zahlung: Häufig Begleichung aus Nachlassmitteln; Steuerschuld bleibt persönlich.
Betriebsvermögen und Unternehmensanteile – Begünstigungen
Betriebsvermögen kann umfassend verschont werden: Die Regelverschonung stellt 85 % des begünstigten Betriebsvermögens steuerfrei; die Optionsverschonung ermöglicht 100 % Steuerfreiheit. Voraussetzungen sind u. a. Fortführung (typisch 5 bzw. 7 Jahre) und Lohnsummenvorgaben; bei sehr großen Vermögen (z. B. > 26 Mio. €) gelten zusätzliche Prüfungen.
Für kleinere Unternehmen kann ein zusätzlicher Abzugsbetrag (typisch bis 150.000 €) den zu versteuernden Rest weiter reduzieren. Werden Auflagen verfehlt, droht eine (teilweise) Nachversteuerung.
- Regelverschonung (85 %): Steuerfreiheit bei mehrjähriger Fortführung und Lohnsummenbindung.
- Optionsverschonung (100 %): Vollverschonung bei strengeren Auflagen und längerer Bindung.
- Kleinbetriebe: Zusätzlicher Abzugsbetrag kann den Restbetrag eliminieren.
- Großvermögen: Ab gestaffelten Schwellen strengere Regeln/Bedürfnisprüfung.
Tarifgrenzen und Ausgleich bei Tarifsprüngen (§ 19 Abs. 3 ErbStG)
Die Erbschaftsteuer steigt stufenweise mit dem steuerpflichtigen Erwerb. Beim Überschreiten einer Wertgrenze würde ohne Korrektur der gesamte Betrag dem höheren Satz unterliegen. § 19 Abs. 3 ErbStG mildert diese Sprünge: Die Mehrsteuer steigt gleitend an, sodass kein unverhältnismäßiger Sprung entsteht.
In Grenzfällen berücksichtigt das Finanzamt den Ausgleich automatisch. Dadurch bleibt die Steuerbelastung bei knappem Grenzübertritt verhältnismäßig, bis der höhere Tarif voll erreicht ist.
Steuererklärung online machen und ∅ 1.328 € kassieren!

- Teure Berater sparen und Steuererklärung selbst machen. Schritt für Schritt per Interview.
- Dank Live-Berechnung sehen Sie sofort, wie viel Geld Sie später vom Staat zurückbekommen.
- Mehrfach getestet und für sehr gut befunden.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Erbschaftssteuer berechnet?
Was sind Steuerklassen und wer gehört dazu?
Welche Freibeträge gelten bei Erbschaften?
Wann bleibt ein geerbtes Familienheim steuerfrei?
Wie kann man die Erbschaftssteuer legal senken?
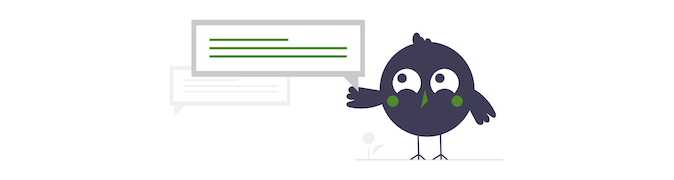
Toni | RECHNER.APP » Assistent
- Ihr digitaler Assistent für individuelle Fragen und verständliche Informationen. Die KI wertet alle Inhalte der Webseite aus und erklärt komplexe Themen einfach.
- Keine Anmeldung erforderlich.
- Kostenlos im Browser.



Quellenangaben und weiterführende Literatur
Die Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert und zusammengetragen. Folgende Quellen und weiterführende Literatur empfehle ich im Kontext Erbschaftssteuer Höhe:
Dieser Beitrag wurde recherchiert und veröffentlicht von Dr. Stephan Seitz
Mein Name ist Dr. Stephan Seitz und ich betreibe RECHNER.APP. Ich habe an der LMU München Jura studiert, 2006 mein Staatsexamen abgelegt und anschließend an der Universität Regensburg promoviert. Mehr zu meinem Werdegang und beruflichen Stationen finden Sie bei Interesse auf LinkedIn.
Die Idee zu dieser Webseite entstand, als ich für meine erste Plattform HEREDITAS » Ratgeber Erbengemeinschaft praktische Online-Rechner entwickelt habe. Die positiven Rückmeldungen meiner Nutzer haben mich motiviert, das Angebot stetig zu erweitern. Heute finden Sie auf RECHNER.APP eine Vielzahl an Rechnern zu unterschiedlichen Anlässen – auch über das Erbrecht hinaus.
Meine Inhalte und die Online-Rechner sind für Sie kostenfrei. Mögliche Werbelinks, die zur Finanzierung beitragen, sind transparent gekennzeichnet.
Sie erreichen mich über die Kontaktseite.

Kommentare
Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!