Schenkungssteuer Höhe berechnen

Zuletzt aktualisiert:
Ihre Lesezeit:
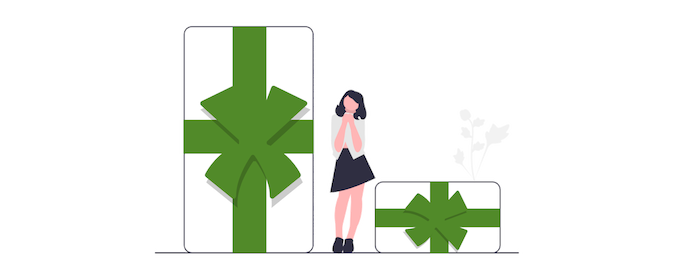
Schenkungssteuer Höhe
- Schenkungssteuer richtet sich nach Steuerklasse, Freibetrag und Wert: Die Steuersätze nach § 19 ErbStG sind progressiv und reichen typischerweise von 7 % bis 50 %; der erreichte Satz wird auf den gesamten steuerpflichtigen Erwerb angewandt. Ein persönlicher Freibetrag wird zuvor abgezogen und kann die Bemessungsgrundlage deutlich reduzieren. Ein Härteausgleich (§ 19 Abs. 3) mildert Sprungbelastungen knapp über Stufengrenzen.
- Freibeträge reduzieren die Steuer und erneuern sich alle zehn Jahre: Freibeträge stehen pro Schenker–Empfänger-Paar erneut nach zehn Jahren zur Verfügung und sind nach Verwandtschaft gestaffelt (z. B. Ehegatten 500.000 €, Kinder 400.000 €, Enkel 200.000 €, übrige Personen meist 20.000 €). Dadurch bleiben viele Familienschenkungen steuerfrei, sofern die Beträge innerhalb der Grenzen bleiben. Durch zeitlich gestaffelte Übertragungen lassen sich Freibeträge mehrfach nutzen und die Steuerlast signifikant senken.
- Schenkungen müssen binnen drei Monaten dem Finanzamt angezeigt werden: Nach § 30 ErbStG sind Schenker und Beschenkter verpflichtet, die Übertragung schriftlich zu melden und dabei Personalien, Art und gemeinen Wert der Zuwendung, Datum sowie das Verwandtschaftsverhältnis anzugeben. Bei notariell beurkundeten Schenkungen meldet oft der Notar zusätzlich, die Pflicht zur eigenen Anzeige bleibt jedoch bestehen. Unterlassene oder falsche Angaben führen zu Bußgeldern, Nachforderungen mit Zinsen und bei Steuerverkürzung zu strafrechtlichen Sanktionen; eine rechtzeitige Selbstanzeige kann strafbefreiend wirken.

Inhaltsverzeichnis
- Schenkungssteuer Höhe: Steuersätze und Freibeträge
- Schenkung dem Finanzamt melden: Anzeigepflicht und Folgen
- Berechnung der Schenkungssteuer und Online-Rechner
- Immobilien schenken: Familienheim und Immobilienbewertung
- Schenkungssteuer sparen: Freibeträge optimal ausschöpfen
- Besondere Fälle: Betriebsvermögen und Stundung
Schenkungssteuer Höhe: Steuersätze und Freibeträge
Die Schenkungssteuer Höhe richtet sich nach Verwandtschaftsgrad (Steuerklasse), persönlichem Freibetrag und dem steuerpflichtigen Wert der Zuwendung. Die Tabelle der Steuersätze (§ 19 ErbStG) reicht von 7 % bis 50 % – je höher der Wert, desto höher der Satz. Der RECHNER.APP Schenkungssteuer Online-Rechner zeigt Ihnen in Sekunden eine erste Einschätzung.
Steuerklassen und Steuersätze im Überblick
Steuersätze werden nach Steuerklasse (I–III) und Wertstufe des steuerpflichtigen Erwerbs angewendet. Maßgeblich ist die Stufe nach Abzug des Freibetrags.
Die folgenden Tarife nach § 19 ErbStG zeigen, wie die Steuer mit steigendem Wert anzieht. Klasse I umfasst z. B. Ehegatten und Kinder, Klasse II u. a. Geschwister, Klasse III alle übrigen Personen. Prüfen Sie zunächst Ihre Klasse, dann die passende Wertstufe, um den Prozentsatz abzulesen.
| Steuerpflichtiger Erwerb | Klasse I | Klasse II | Klasse III |
|---|---|---|---|
| bis 75.000 € | 7 % | 15 % | 30 % |
| 75.000–300.000 € | 11 % | 20 % | 30 % |
| 300.000–600.000 € | 15 % | 25 % | 30 % |
| 600.000–6.000.000 € | 19 % | 30 % | 30 % |
| 6.000.000–13.000.000 € | 23 % | 35 % | 50 % |
| 13.000.000–26.000.000 € | 27 % | 40 % | 50 % |
| > 26.000.000 € | 30 % | 43 % | 50 % |
Persönliche Freibeträge bei Schenkungen
Freibeträge reduzieren die Bemessungsgrundlage; nur der übersteigende Teil wird besteuert. Die Höhe hängt vom Verhältnis zwischen Schenker und Beschenktem ab und kann alle zehn Jahre erneut genutzt werden. Dadurch bleiben viele Familienschenkungen vollständig steuerfrei.
Die wichtigsten Freibeträge im Überblick – jeder gilt pro Schenker und Empfänger separat:
- Ehegatte/Lebenspartner: 500.000 € Freibetrag.
- Kinder/Stiefkinder: 400.000 € Freibetrag pro Elternteil.
- Enkelkinder: 200.000 € (direkte Schenkung Großeltern → Enkel).
- Eltern oder Großeltern, die von ihren Kindern/Enkeln etwas erhalten: 20.000 € Freibetrag (Steuerklasse II). Umgekehrt gilt bei Schenkungen von Eltern an Kinder der Freibetrag von 400.000 €.
- Geschwister, Nichten/Neffen, übrige Personen: 20.000 €.
Zehnjahresfrist – Freibeträge alle zehn Jahre nutzen
Die Freibeträge erneuern sich alle zehn Jahre pro Personenpaar; frühere Zuwendungen werden innerhalb dieser Frist zusammengerechnet. Dadurch lassen sich größere Vermögen in Etappen übertragen – mit deutlich geringerer Steuerlast. Bereits gezahlte Steuer auf Vorerwerbe wird bei der Berechnung späterer Schenkungen innerhalb des 10-Jahres-Zeitraums angerechnet.
Praxisrelevant ist die Staffelung: Statt einmalig oberhalb des Freibetrags zu schenken, verteilen viele Familien Vermögen in mehrjährigen Abständen. So bleibt jede Tranche im Freibetrag oder fällt in eine niedrigere Tarifstufe. Achten Sie darauf, Schenkungen korrekt anzuzeigen und Vorerwerbe stets mitzuteilen – das Finanzamt prüft die Summen je Zehnjahreszeitraum.
Steuererklärung online machen und ∅ 1.328 € kassieren!

- Teure Berater sparen und Steuererklärung selbst machen. Schritt für Schritt per Interview.
- Dank Live-Berechnung sehen Sie sofort, wie viel Geld Sie später vom Staat zurückbekommen.
- Mehrfach getestet und für sehr gut befunden.
Schenkung dem Finanzamt melden: Anzeigepflicht und Folgen
Schenkungen müssen dem Finanzamt angezeigt werden. § 30 ErbStG verpflichtet sowohl Schenker als auch Beschenkten, innerhalb von drei Monaten eine Mitteilung abzugeben. Wer dies versäumt oder falsche Angaben macht, riskiert Bußgelder, Nachzahlungen und sogar strafrechtliche Folgen.
Schenkungsanzeige: Wer meldet was bis wann (§ 30 ErbStG)
Nach § 30 ErbStG gilt eine Frist von drei Monaten ab Vollzug der Schenkung. Innerhalb dieses Zeitraums müssen Schenker und Beschenkter das Finanzamt informieren. Dies erfolgt schriftlich – in der Regel über das vom Finanzamt bereitgestellte Formular. Entscheidend ist, dass die Angaben vollständig und korrekt sind.
Die Anzeige muss bestimmte Kerninformationen enthalten. Dazu zählen:
- Personalien: Name und Anschrift von Schenker und Beschenktem.
- Beschreibung: Art des Geschenks, z. B. Geldbetrag, Immobilie, Wertpapiere.
- Wert: Angabe des gemeinen Werts zum Zeitpunkt der Übertragung.
- Datum: Tag, an dem die Schenkung vollzogen wurde.
- Verwandtschaftsverhältnis: wichtig für Steuerklasse und Freibetrag.
Bei notariell beurkundeten Schenkungen wie Immobilien oder GmbH-Anteilen übermittelt der Notar automatisch eine Meldung an das Finanzamt. Dennoch sind die Beteiligten verpflichtet, die Anzeige eigenständig einzureichen.
Konsequenzen bei Nicht-Anzeige oder falschen Angaben
Wer eine Schenkung nicht oder falsch anzeigt, riskiert rechtliche Folgen. Das einfache Versäumnis kann als Ordnungswidrigkeit nach § 378 AO ein Bußgeld nach sich ziehen. Wird dadurch die Steuer verkürzt, liegt eine Steuerhinterziehung nach § 370 AO vor – eine Straftat mit empfindlichen Konsequenzen.
In der Praxis bedeutet das: Das Finanzamt fordert nicht nur die entgangene Steuer nach, sondern erhebt zusätzlich Zinsen nach § 233a AO. Bei vorsätzlicher Nichtmeldung können hohe Geldstrafen oder in schweren Fällen Freiheitsstrafen verhängt werden. Wer erkennt, dass er die Frist verpasst hat, sollte rasch eine Selbstanzeige erwägen, um Straffreiheit zu sichern.
Berechnung der Schenkungssteuer und Online-Rechner
Die Höhe der Schenkungssteuer ergibt sich aus mehreren Faktoren: dem Wert der Schenkung, dem anwendbaren Freibetrag, der Steuerklasse und den Vorschenkungen der letzten zehn Jahre. Erst nach Abzug des Freibetrags wird der zutreffende Steuersatz angewendet. Der RECHNER.APP Schenkungssteuer Online-Rechner berücksichtigt diese Parameter und liefert in Sekunden eine erste Prognose.
Faktoren zur Berechnung der Schenkungssteuer
Für die Berechnung ist entscheidend, welcher Betrag nach Abzug des Freibetrags übrig bleibt. Auf diese Bemessungsgrundlage wird der Steuersatz der jeweiligen Klasse angewandt. Vorschenkungen im Zehnjahreszeitraum werden addiert; Sonderbefreiungen wie Familienheim oder Betriebsvermögen mindern den Wert. So entsteht die steuerpflichtige Bereicherung, die das Finanzamt ansetzt.
Die maßgeblichen Rechengrößen im Überblick:
- Wert der Schenkung: Geld, Immobilien oder andere Vermögenswerte.
- Persönlicher Freibetrag: abhängig vom Verwandtschaftsgrad.
- Steuerklasse und Steuersatz: bestimmt die prozentuale Belastung.
- Vorschenkungen: werden innerhalb von zehn Jahren zusammengerechnet.
- Steuerbefreiungen: z. B. Familienheim oder begünstigtes Betriebsvermögen.
Schenkungssteuer-Rechner nutzen: Eingaben und Ergebnis
Der RECHNER.APP Schenkungssteuer Online-Rechner ist kostenlos und anonym nutzbar. Er fragt die zentralen Eingaben ab: den Wert der Schenkung nach Vermögensklassen und Schulden sowie das Verwandtschaftsverhältnis. Aus diesen Daten ermittelt er den steuerpflichtigen Betrag und den anzuwendenden Steuersatz. Das Ergebnis zeigt die voraussichtliche Steuerhöhe in Euro sowie den berücksichtigten Freibetrag.
Damit erhalten Sie eine schnelle Orientierung, ob und in welcher Höhe Steuer anfällt. Beachten Sie aber: Der Rechner ersetzt keine amtliche Festsetzung. Immobilienwerte müssen Sie realistisch einschätzen, Sonderregeln wie Nießbrauch oder Betriebsvermögen sind nur eingeschränkt abbildbar. Für komplexe Fälle ist ergänzend fachliche Beratung sinnvoll.
Ermitteln Sie vor jeder Schenkung zuerst Ihre Steuerklasse und den persönlichen Freibetrag – nur der übersteigende Betrag wird besteuert. Nutzen Sie die Zehnjahresfrist und staffeln Sie größere Übertragungen (z. B. Eltern je 400.000 € pro Kind alle 10 Jahre), um hohe Steuersätze zu vermeiden. Melden Sie jede Schenkung innerhalb von drei Monaten beim Finanzamt oder erwägen Sie bei Fristversäumnis umgehend eine Selbstanzeige, um Nachzahlungen, Zinsen und strafrechtliche Risiken zu verhindern.

Persönlicher Experten-Tipp von Dr. Stephan Seitz
Immobilien schenken: Familienheim und Immobilienbewertung
Bei Immobilien bestimmt nicht nur der Marktwert die Schenkungssteuer Höhe, sondern auch besondere Befreiungen und Abschläge. Das Familienheim kann unter Ehegatten vollständig steuerfrei übertragen werden, wenn der Beschenkte es unverzüglich und mindestens zehn Jahre selbst bewohnt. Für vermietete Wohnimmobilien gilt zudem häufig nur ein 90 %-Wertansatz, während Nießbrauch und Wohnrechte den steuerpflichtigen Wert weiter mindern.
Steuerbefreiung fürs Familienheim
Eine Schenkung des selbstgenutzten Familienheims an Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner kann unabhängig vom Immobilienwert schenkungssteuerfrei sein. Voraussetzung ist, dass der Beschenkte die Immobilie unverzüglich als Hauptwohnsitz nutzt und die Selbstnutzung in der Regel mindestens zehn Jahre fortführt. Wird die Selbstnutzung vorzeitig aufgegeben, droht die nachträgliche Schenkungssteuer – Ausnahmen gelten nur bei besonderen Gründen wie Tod oder Pflegebedürftigkeit.
Für Kinder gibt es bei der Schenkung keine vollständige Familienheim-Befreiung; hier greifen die allgemeinen Freibeträge (typisch 400.000 € pro Elternteil). In der Praxis lohnt sich daher eine vorausschauende Planung: Ehegatten können durch steuerfreie Übertragungen Vermögen strukturieren, bevor weitere Schenkungen an Kinder innerhalb der Freibeträge erfolgen. Die Meldepflicht gegenüber dem Finanzamt bleibt davon unberührt und muss fristgerecht erfüllt werden.
Immobilienwert ermitteln für die Schenkungssteuer
Maßgeblich ist grundsätzlich der Verkehrswert der Immobilie zum Zeitpunkt der Schenkung. Das Finanzamt ermittelt ihn je nach Objekt über Vergleichs-, Sach- oder Ertragswertverfahren; entscheidend ist der realistische Marktwert. Steuerliche Besonderheiten reduzieren die Bemessungsgrundlage: Vermietete Wohnimmobilien werden häufig nur mit 90 % des Werts angesetzt, und ein vorbehaltener Nießbrauch oder ein Wohnrecht mindert den steuerpflichtigen Erwerb zusätzlich.
Damit Sie die Wertansätze nachvollziehen können, helfen drei Kernpunkte als Checkliste:
- Vermietete Wohnimmobilie: Häufiger 90 %-Ansatz; 10 % Verschonung reduziert die Schenkungssteuer Höhe spürbar.
- Nießbrauch/Wohnrecht: Der kapitalisierte Wert der Nutzung (z. B. Miete) wird vom Immobilienwert abgezogen.
- Keine Grunderwerbsteuer: Unentgeltliche Übertragungen (Schenkungen) lösen keine Grunderwerbsteuer aus.
Für die Praxis bedeutet das: Zunächst den realistischen Marktwert bestimmen, anschließend mögliche Abschläge (Vermietung, Rechte) berücksichtigen und erst dann Freibetrag und Steuersatz anwenden. So erhalten Sie die steuerpflichtige Bereicherung, die Grundlage für die spätere Veranlagung ist.
 Schenkungssteuer Höhe: Meine weiteren Artikel
Schenkungssteuer Höhe: Meine weiteren Artikel
 Schenkungssteuer Immobilien berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Schenkungssteuer Immobilien berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 28. Mai 2025 Schenkungssteuer Kind berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Schenkungssteuer Kind berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 28. Mai 2025 Schenkungssteuer TabelleAutor: Dr. Stephan Seitz
Schenkungssteuer TabelleAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 12. September 2025 Schenkungssteuer berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Schenkungssteuer berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 28. Mai 2025 Schenkungssteuer Enkel berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Schenkungssteuer Enkel berechnenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 28. Mai 2025
Schenkungssteuer sparen: Freibeträge optimal ausschöpfen
Mit kluger Planung lässt sich die Schenkungssteuer Höhe deutlich reduzieren: Freibeträge werden gezielt genutzt, Schenkungen zeitlich gestaffelt und rechtlich saubere Wege gewählt. Wer Werte in Etappen überträgt und Verwandtschaftsstrukturen einbindet, vermeidet unnötige Steuerlast – ohne rechtliche Risiken einzugehen.
Schenkungen clever planen und Freibeträge ausnutzen
Gestaffelte Schenkungen nutzen die Freibeträge mehrfach: Nach zehn Jahren stehen sie zwischen denselben Personen erneut zur Verfügung. Verteilen Eltern große Vermögen auf Etappen, bleiben einzelne Tranchen im Freibetrag oder fallen in niedrigere Tarifstufen – so sinkt die effektive Steuerbelastung spürbar.
So planen Familien die Schritte strukturiert:
- Teilübertragungen: Vermögen in mehreren Tranchen innerhalb von >10 Jahren statt einmalig übertragen.
- Beide Eltern einbinden: Pro Kind lassen sich zwei Freibeträge (je 400.000 €) ausschöpfen.
- Früh beginnen: Rechtzeitig starten, damit mehrere 10-Jahres-Zyklen möglich sind.
Ein Elternpaar kann einem Kind alle zehn Jahre zusammen bis zu 800.000 € steuerfrei zuwenden; nach 20 Jahren sind so 1,6 Mio. € möglich. Wer nur einen großen Einmalbetrag überträgt, verschenkt diese Chance – und rutscht oft in höhere Steuersätze.
Kettenschenkung – mehrere Freibeträge legal kombinieren
Bei der Kettenschenkung wird Vermögen nacheinander über nahe Angehörige weitergegeben, um mehrere Freibeträge zu nutzen. Entscheidend ist die zivilrechtliche Wirksamkeit jeder Stufe: Der zwischengeschenkte Empfänger muss rechtlich frei über das Geschenk verfügen können. Besteht eine vertragliche Verpflichtung zur sofortigen Weitergabe, erkennt das Finanzamt die Kettenschenkung nicht an.
Typischer Anwendungsfall Großeltern → Eltern → Enkel: Statt direkt an den Enkel (Freibetrag 200.000 €) zu schenken, nutzen Großeltern zunächst den Freibetrag zum eigenen Kind (400.000 €) und dieses anschließend seinen Freibetrag zum Enkel (400.000 €). So fließen hohe Summen steuerfrei – rechtssicher umgesetzt und ohne Scheinabreden.
Übernahme der Schenkungssteuer durch den Schenker
Steuerschuldner ist der Beschenkte; der Schenker kann die Steuer freiwillig übernehmen. Diese Übernahme gilt als zusätzliche Schenkung und wird der Bereicherung zugerechnet – die Steuer wird daher hochgerechnet (Bruttomethode) und insgesamt teurer.
Besondere Fälle: Betriebsvermögen und Stundung
Bei Unternehmensübertragungen und bestimmten Vermögenswerten gelten Sonderregeln. Für begünstigtes Betriebsvermögen sieht das Gesetz Verschonungsabschläge von 85 % oder sogar 100 % vor, damit Betriebe im Familienbesitz bleiben können. Außerdem ist in Härtefällen eine Stundung der Schenkungssteuer möglich, um Verkäufe zur sofortigen Steuerzahlung zu vermeiden.
Steuervergünstigungen für Unternehmensvermögen
Betriebsvermögen, Anteile an Kapitalgesellschaften über 25 % sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe werden steuerlich privilegiert. Bei Einhaltung der Behaltensfristen (fünf bzw. sieben Jahre) und Lohnsummenregelungen können 85 % oder sogar 100 % des Vermögens von der Schenkungssteuer verschont bleiben. Dadurch sinkt die effektive Steuerlast bei hohen Firmenwerten dramatisch.
Die wichtigsten Eckpunkte im Überblick:
- 85 % Verschonung: Betrieb mindestens fünf Jahre fortführen und Lohnsumme sichern.
- 100 % Verschonung: Strengere Voraussetzungen, sieben Jahre Fortführung, nur für bestimmte Größenklassen.
- Missbrauch ausgeschlossen: Reines Finanzvermögen (z. B. „Cash-GmbH“) ist nicht begünstigt.
- Lohnsummenregelung: Gilt nur bei Betrieben mit mehr als fünf Beschäftigten; kleinere Betriebe sind davon ausgenommen.
Damit ist es möglich, Unternehmenswerte in Millionenhöhe nahezu steuerfrei auf die nächste Generation zu übertragen – eine zentrale Grundlage der deutschen Unternehmensnachfolgeplanung.
Stundung der Schenkungssteuer (§ 28 ErbStG)
Kann die Steuer nicht sofort gezahlt werden, ist eine Stundung nach § 28 ErbStG möglich. Betroffen sind vor allem Betriebsvermögen, landwirtschaftliche Flächen oder Immobilien. Das Finanzamt kann die Steuer auf Antrag zeitlich verschieben, um eine Zwangsveräußerung zu vermeiden.
Die wichtigsten Punkte für die Praxis:
- Antragspflicht: Der Beschenkte muss rechtzeitig einen Stundungsantrag stellen.
- Zeitlicher Rahmen: Stundung meist für mehrere Jahre möglich, teils bis zu zehn Jahre.
- Kosten: Häufig werden Zinsen erhoben; in Einzelfällen ist eine zinsfreie Stundung vorgesehen.
Wird der Antrag abgelehnt, können Einspruch und notfalls Klage helfen. Die Steuer wird nicht erlassen, sondern lediglich aufgeschoben – sie ist später in Raten oder auf einmal zu begleichen.
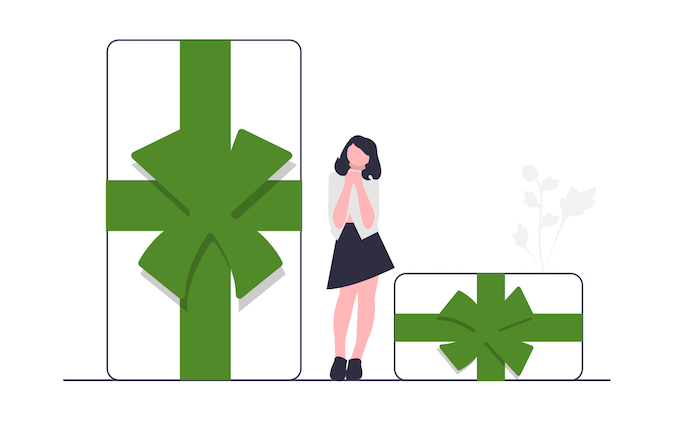
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Schenkungssteuer berechnet?
Welche Freibeträge gelten bei Schenkungen?
Muss eine Schenkung dem Finanzamt gemeldet werden und bis wann?
Was bedeutet die Zehnjahresfrist bei Freibeträgen?
Wie kann man Schenkungssteuer legal reduzieren?
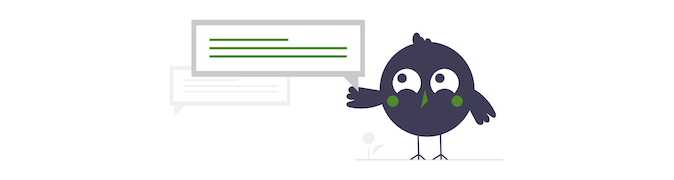
Toni | RECHNER.APP » Assistent
- Ihr digitaler Assistent für individuelle Fragen und verständliche Informationen. Die KI wertet alle Inhalte der Webseite aus und erklärt komplexe Themen einfach.
- Keine Anmeldung erforderlich.
- Kostenlos im Browser.



Quellenangaben und weiterführende Literatur
Die Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert und zusammengetragen. Folgende Quellen und weiterführende Literatur empfehle ich im Kontext Schenkungssteuer Höhe:
Dieser Beitrag wurde recherchiert und veröffentlicht von Dr. Stephan Seitz
Mein Name ist Dr. Stephan Seitz und ich betreibe RECHNER.APP. Ich habe an der LMU München Jura studiert, 2006 mein Staatsexamen abgelegt und anschließend an der Universität Regensburg promoviert. Mehr zu meinem Werdegang und beruflichen Stationen finden Sie bei Interesse auf LinkedIn.
Die Idee zu dieser Webseite entstand, als ich für meine erste Plattform HEREDITAS » Ratgeber Erbengemeinschaft praktische Online-Rechner entwickelt habe. Die positiven Rückmeldungen meiner Nutzer haben mich motiviert, das Angebot stetig zu erweitern. Heute finden Sie auf RECHNER.APP eine Vielzahl an Rechnern zu unterschiedlichen Anlässen – auch über das Erbrecht hinaus.
Meine Inhalte und die Online-Rechner sind für Sie kostenfrei. Mögliche Werbelinks, die zur Finanzierung beitragen, sind transparent gekennzeichnet.
Sie erreichen mich über die Kontaktseite.

Kommentare
Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!